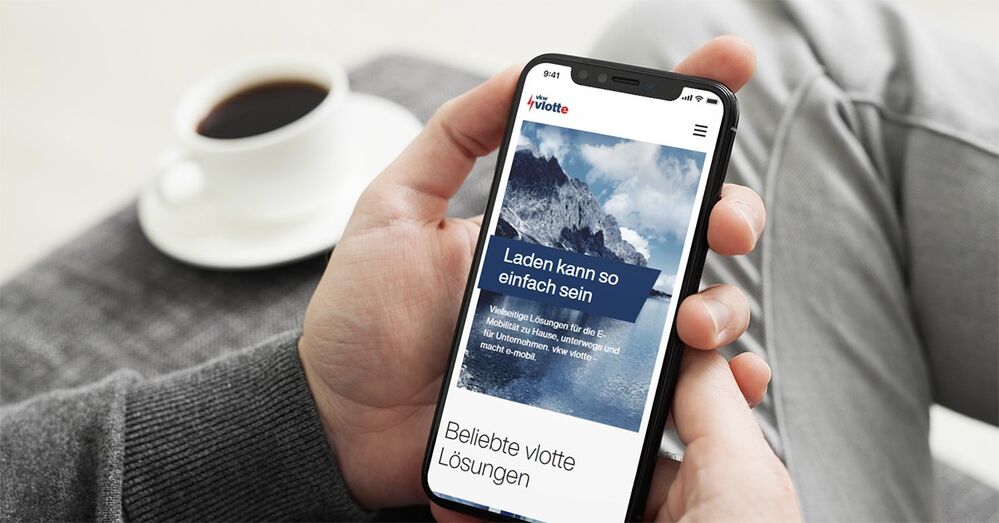Bei Anschaffung einer Wallbox sollten mehrere Punkte bedacht werden:
1. Ladeleistung
An den vlotte Wallboxen im Einfamilienhaus kann eine Ladeleistung von 3,7 bis 22 kW eingestellt werden. Wohnen Sie in einer Wohnanlage, garantieren wir Ihnen eine Mindestladeleistung von 5 kW.
Die Ladedauer und Ladegeschwindigkeit wird aber zusätzlich noch vom Elektroauto selbst und vom Ladekabel beeinflusst. Die Komponente mit den niedrigsten Kennzahlen ist dabei ausschlaggebend für das Endresultat. Ist Ihr Elektroauto zum Beispiel mit einem Ladegerät von 3,7 kW ausgestattet, wird es auch dann mit genau dieser Leistung laden, auch wenn die Wallbox und das Ladekabel bis zu 22 kW zulassen würden. Informationen zu der Ladeleistung Ihres Elektroautos finden Sie in der Regel in der Fahrzeugbeschreibung.
2. Steckersystem
Sollte Ihr Elektroauto den europäischen Standardstecker (Typ 2) haben, bietet sich die vlotte Wallbox mit fest installiertem Kabel an. Dies ist deutlich komfortabler, weil das Ladekabel nicht ständig aus dem Kofferraum entnommen und an die Wallbox und das Fahrzeug gesteckt werden muss.
Vereinzelt gibt es aber auch noch Fahrzeuge mit Typ 1 Stecker, insbesondere asiatische und amerikanische Modelle wie beispielsweise der Nissan Leaf der ersten Generation. Hier empfiehlt sich die vlotte Wallbox ohne fix angeschlossenem Ladekabel, an die je nach Bedarf das entsprechende Mode 3 Ladekabel angeschlossen werden kann. Mit dieser Ladestation sind Sie komplett flexibel.
3. Zusatzfunktionen
Am wichtigsten ist das sichere, schnelle und komfortable Laden Ihres Elektroautos zu Hause. Unsere smarte Wallbox für das Einfamilienhaus hat zusätzliche Funktionen, wie folgende:
• Integration einer Photovoltaikanlage: Mit einem entsprechenden Energiemanager kann der selbsterzeugte Solarstrom Ihrer PV-Anlage auch zum Aufladen Ihres Elektroautos genutzt werden.
• Zugangsbeschränkung (per RFID): Damit wird sichergestellt, dass die Ladestation nur von berechtigten Personen genutzt werden könnte.
Unsere Wallboxen für Wohnanlagen haben neben der Zugangsbeschränkung auch eine sogenannte "Lastmanagement"-Funktion, wodurch mehrere Elektroautos zur selben Zeit bei gleichbleibender Anschlussleistung laden können. Die verfügbare Leistung verteilt sich automatisch auf die Anzahl der ladenden Elektroautos.
4. Installation
Grundsätzlich empfehlen wir, die Installation einer Ladestation für Elektroautos ausschließlich durch einen zertifizierten Elektroinstallateur durchführen zu lassen, der mit den Normen und Anforderungen für den Anschluss einer Wallbox vertraut ist. Der Elektriker klärt zudem vor der Installation auch mit dem Netzbetreiber ab, ob genügend Leistung für die Installation der Ladestation vorhanden ist (Netzanschlussfrage). In Wohnanlagen erfolgt die Installation automatisch nach Bestellung der Wallbox.
5. Kosten
Die Installationskosten richten sich nach den jeweiligen Gegebenheiten vor Ort. Insbesondere ist zu prüfen, ob Wanddurchbrüche, Grabungsarbeiten oder Kabelverlegungen erforderlich sind. Unser Tipp: Lassen Sie sich hierzu von einem qualifizierten Elektroinstallateur ein unverbindliches Angebot machen. In Wohnanlagen erfolgt die Installation kostenlos. Die Kosten für die Wallbox wiederum können Sie unserem jeweiligen Produktangebot entnehmen.